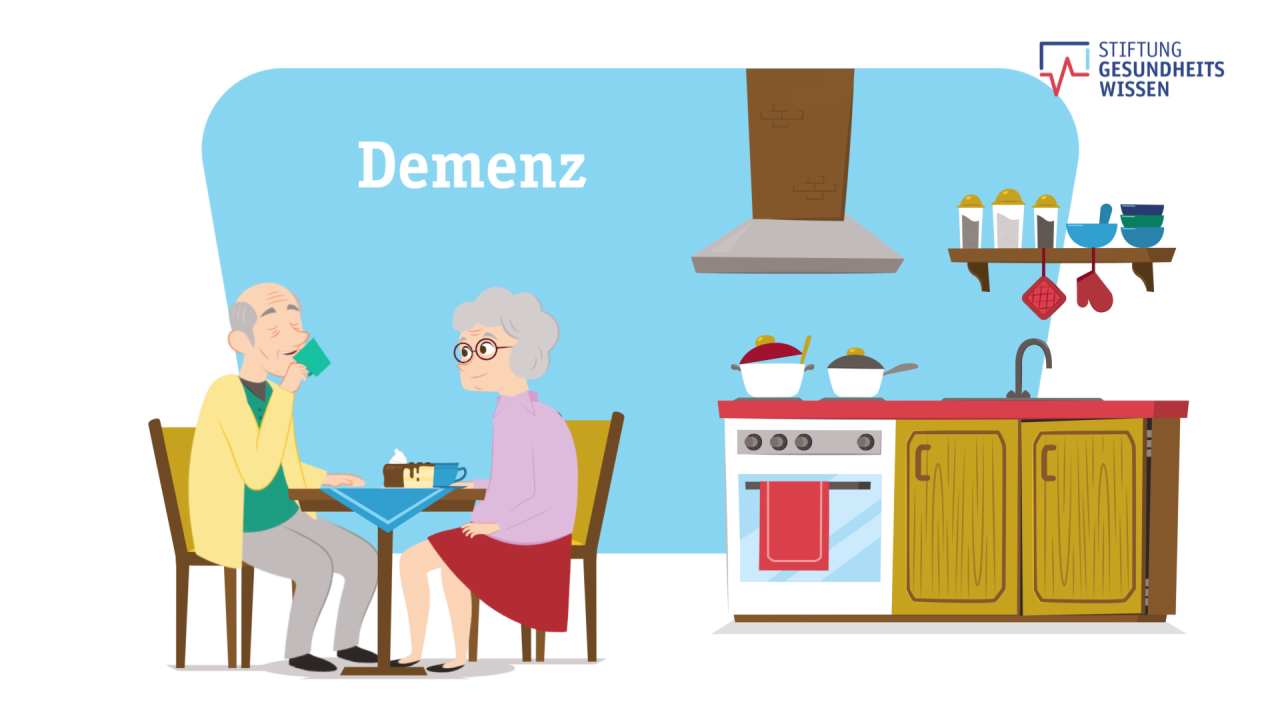Alzheimer-Demenz ist eine Demenz-Form. Sie wird auch Morbus Alzheimer nach dem Psychiater Alois Alzheimer benannt, der sie vor mehr als hundert Jahren als Erster beschrieben hat. Die Krankheit beginnt meist nach dem 65. Lebensjahr.
Neben der Alzheimer-Demenz gibt es noch weitere Demenzformen wie zum Beispiel die vaskuläre Demenz, die frontotemporale Demenz und die Lewy-Körper-Demenz (auch Lewy-Körper Demenz oder Lewy-Body-Demenz genannt). Auch gemischte Demenzerkrankungen sind möglich.
Die Alzheimer-Demenz ist die häufigste Demenz-Form. Sie macht 50 bis 70 Prozent aller Demenz-Erkrankungen aus. Die meisten Fälle betreffen Menschen, die älter als 65 Jahre sind Das Risiko zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter. Alzheimer-Demenz kann auch zusammen mit anderen Demenz-Formen auftreten, z. B. mit vaskuläre Demenz.
Entstehung und Risikofaktoren
Bei Alzheimer-Demenz kommt es zu krankhaften Veränderungen im Gehirn. So bildet sich innerhalb der Gehirnzellen ein Eiweiß namens Tau. Um die Gehirnzellen herum lagert sich ein anderes Eiweiß namens Beta-Amyloid ab. Dadurch werden Verbindungen innerhalb und zwischen den Hirnzellen zunehmend gestört und Gehirnzellen sterben nach und nach ab.
Bisher ist noch nicht vollständig geklärt, warum es zu diesen Veränderungen kommt. Manche Menschen erben die Alzheimer-Erkrankung von einem Angehörigen. Bei ihnen werden die Veränderungen durch bestimmte Gene hervorgerufen. Man weiß auch nicht, ob das Tau-Eiweiß oder das Beta-Amyloid-Eiweiß letztlich für die Demenz verantwortlich ist. Außerdem ist unklar, ob es außer den veränderten Eiweißen noch weitere Ursachen gibt.
Anzeichnen und Beschwerden
Bei Alzheimer-Demenz kommt es zu Gedächtnisstörungen, die über einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten immer wieder auftreten. Diese Störungen werden mit der Zeit ausgeprägter. Erste Anzeichen können sein, dass man Termine vergisst oder Schwierigkeiten hat, sich in einer neuen Umgebung zurechtzufinden. Manche Menschen mit Alzheimer vergessen auch, welcher Tag oder welches Jahr gerade ist. Anderen fällt das Sprechen schwerer, weil sie Wörter vergessen.
Außerdem können psychische Beschwerden auftreten. Menschen mit Alzheimer-Demenz fühlen sich oft gereizt und unruhig, sodass sie in Streit mit anderen geraten. Man kann sich auch niedergeschlagen fühlen, sodass man keine Lust mehr hat am Leben teilzunehmen. Auch Appetitlosigkeit und Essstörungen sowie Schlafstörungen sind mögliche Anzeichen für Alzheimer-Demenz.
Verlauf
Alzheimer-Demenz ist eine fortschreitende Erkrankung. Das bedeutet, dass mit der Zeit immer mehr Gehirnzellen absterben. Dadurch nehmen auch die Beschwerden immer weiter zu. Menschen mit Alzheimer-Demenz sind dann immer mehr auf die Hilfe anderer angewiesen. Der Verlauf der Alzheimer-Demenz lässt sich in drei Stufen einteilen. Die Übergänge zwischen den Stufen sind fließend.
Kein Mensch mit Alzheimer-Demenz gleicht dem anderen. Die Erkrankung kann unterschiedlich schnell voranschreiten. Nicht immer treten alle genannten Beeinträchtigungen auf.
Alzheimer-Demenz ist keine tödliche Erkrankung. Die Lebenserwartung hängt sehr stark vom Zeitpunkt der Diagnose, dem Alter bei der Diagnose, dem Krankheits-Stadium der Alzheimer-Demenz und weiteren persönlichen Umständen wie Begleiterkrankungen ab. Außerdem verläuft jede Alzheimer-Erkrankung anders. Man kann deshalb nicht vorhersagen, wie alt ein Mensch mit Alzheimer-Demenz wird.
Die Entwicklung der Alzheimer-Demenz lässt sich in mehrere Phasen einteilen. In der ersten Phase beginnen bereits die Veränderungen im Gehirn. Die Veränderungen machen sich aber noch nicht durch Beschwerden bemerkbar. Diese Phase dauert etwa zehn Jahre. Es folgt ein weiterer Abschnitt der Krankheit, in dem erste, leichte Beschwerden und frühe Anzeichen auftreten. Er hält etwa vier Jahre an. In der Regel wird nach diesen vier Jahren die Diagnose gestellt. Die meisten Menschen leben danach noch etwa sechs Jahre. Menschen mit Alzheimer-Demenz können aber auch länger leben.
Diagnostik
Wer Sorge hat, an Alzheimer-Demenz erkrankt zu sein, kann zunächst mit dem Hausarzt, der Hausärztin darüber sprechen. Er oder sie wird durch gezielte Fragen versuchen herauszufinden, ob es sich tatsächlich um Demenz handelt. Wenn sich der Verdacht bestätigt, helfen weitere Untersuchungen dabei, die genaue Demenz-Form festzustellen.
Dafür kommen verschiedene Tests infrage: Sie reichen von einfachen Aufgaben, die mit Stift und Papier gelöst werden, über Blutuntersuchungen bis hin zu Bildaufnahmen vom Gehirn. Diese Untersuchungen sind in der Gesundheitsinformation Demenz genauer beschrieben.
In vielen Fällen kann man nach diesen Untersuchungen schon sagen, ob es sich um Alzheimer-Demenz handelt. Für unklare Fälle gibt es darüber hinaus besondere Methoden, um Alzheimer-Demenz von anderen Demenz-Formen abzugrenzen. Diese werden jedoch nur in Ausnahmefällen angewandt. Die Ergebnisse der verschiedenen Untersuchungen müssen immer als Gesamtbild betrachtet werden. Manchmal lässt sich trotz umfassender Untersuchungen nicht sicher einordnen, welche Demenzform vorliegt.
Nur ein ganz kleiner Teil der Alzheimer-Erkrankungen ist vererbt. In diesen Fällen spricht man von familiärer Alzheimer-Demenz (FAD). Diese Alzheimer-Form tritt in der Regel früh auf, also vor dem 65. Lebensjahr. Als Ursache gelten Veränderungen der Erbinformationen auf einem von drei bestimmten Genen. Diese werden mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent an die Nachkommen vererbt. Wer den Verdacht hat, von familiärer Alzheimer-Demenz betroffen zu sein, kann sich an spezielle Beratungsstellen wenden. Ein Verdacht besteht etwa, wenn die familiäre Alzheimer-Demenz bei einem Elternteil nachgewiesen wurde. Nach der Beratung kann eine genetische Untersuchung stattfinden, um festzustellen, ob man das veränderte Gen geerbt hat. Das Untersuchungs-Ergebnis kann weitreichende Folgen haben, wenn man das Gen wirklich geerbt hat. Deshalb sollte man gut abwägen, ob man die Untersuchung machen möchte.
Wenn Sie mehr über genetische Tests zum Risiko von Alzheimer-Demenz und möglichen Vor- und Nachteilen wissen wollen, lesen Sie weiter.
Gibt es in Deutschland genetische Tests, mit denen man die Wahrscheinlichkeit bestimmen kann, später an Alzheimer-Demenz zu erkranken?
Wenn in der Familie jemand an Alzheimer-Demenz erkrankt, fragen sich viele Angehörige, ob sie die Erkrankung womöglich geerbt haben. Veränderungen im Erbgut können das Risiko beeinflussen, ob man an Alzheimer-Demenz erkrankt. Wenn in einer Familie viele Personen Alzheimer haben oder hatten, kann das ein Hinweis auf Veränderungen im Erbgut sein. Ein weiterer Hinweis ist, wenn die betroffenen Personen vor dem 65. Lebensjahr erkrankten.