Hintergrund
Jeder kennt Tage, an denen man sich niedergeschlagen fühlt. Neben persönlichen Enttäuschungen oder Ärger im Job kann auch einfach schlechtes Wetter auf die Stimmung schlagen. Manche Menschen fühlen sich dann umgangssprachlich „deprimiert“. Solche Phasen gehören zum Leben dazu und in der Regel gehen sie auch ganz von selbst wieder vorbei.
Wenn die gedrückte Stimmung jedoch zum Dauerzustand wird und den Alltag beeinträchtigt, liegt möglicherweise eine psychische Erkrankung vor – eine Depression. Sie kann in jedem Alter und in jeder Lebenssituation auftreten. Typische Anzeichen für eine Depression sind:
- Man fühlt sich dauernd niedergeschlagen und traurig.
- Man verliert das Interesse an Freunden, Hobbys und anderen Dingen, die einem früher Freude bereitet haben.
- Es fällt einem schwer, sich zu täglichen Aufgaben und Unternehmungen „aufzuraffen“.
Depressionen können sich von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich äußern. Manche leiden unter starken Selbstzweifeln und grübeln viel. Auch Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen oder mangelnder Appetit weisen auf Depressionen hin. Eine Depression kann das gesamte Leben und Wohlbefinden eines Menschen beeinträchtigen.
Die Erkrankung tritt in unterschiedlichen Formen auf und hält unterschiedlich lange an. Eine Depression kann als einzelne Episode auftreten. Es gibt aber auch wiederkehrende, in der Fachsprache auch rezidivierend genannte depressive Episoden.
Symptome und Verlauf
Von Mensch zu Mensch zeigen sich Depressionen in unterschiedlichen Ausprägungen. Beschwerden, die auf eine Depression hinweisen, können sich sowohl seelisch als auch körperlich äußern. Häufige Anzeichen sind:
- gedrückte Stimmung, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung oder das Gefühl, innerlich „leer“ zu sein
- Man verliert das Interesse und die Freude an alltäglichen Tätigkeiten, etwa an der Arbeit oder im Haushalt, aber auch an Hobbys oder Unternehmungen mit Freunden.
- Man fühlt sich kraft- und antriebslos.
Meistens werden diese Symptome von weiteren Beschwerden begleitet, z. B.:
- verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit
- vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
- Gefühle von Schuld und Wertlosigkeit
- Schlafstörungen
- innere Unruhe, sich gehetzt fühlen
- verzögerte Reaktionen, langsame Bewegungen
- verminderter Appetit
- Hoffnungslosigkeit, schlechte Erwartungen an die Zukunft
- Gedanken, dass man nicht mehr leben möchte, oder sogar Suizidversuche. Solche Gedanken sind Warnzeichen, dass Sie sich dringend Hilfe holen sollten.
Unter Umständen berichten Menschen, die an Depression erkranken, auch von anderen Beschwerden, die auf den ersten Blick vielleicht nicht mit Depression in Verbindung gebracht werden, z. B. körperliche Abgeschlagenheit, Kraftlosigkeit, Druckgefühl im Hals und in der Brust oder Gedächtnisstörungen. Auch Magen-Darm-Beschwerden, Schwindelgefühle oder Herzrhythmus-Störungen können auftreten. Andere berichten über sexuelle Funktionsstörungen, das Ausbleiben der Menstruation oder Libidoverlust.
Eine Depression verläuft meist in Episoden. Das bedeutet, dass die Krankheitsphasen zeitlich begrenzt sind. Manchmal klingen sie auch ohne Behandlung ab. Aus der Zeit, bevor es Medikamente gegen Depression gab, schätzt man, dass eine depressive Episode durchschnittlich sechs bis acht Monate andauerte. Durch eine entsprechende Behandlung lässt sie sich auf geschätzt etwa vier Monate verkürzen.
Aber nicht alle Depressionen verschwinden von selbst wieder. Es kann auch vorkommen, dass die Beschwerden sich nach der depressiven Episode zwar bessern, aber nicht vollständig weggehen.
Eine Depression kann auch in wiederkehrenden (rezidivierenden) depressiven Episoden verlaufen. Dabei folgen die erneuten Episoden in kurzer Zeit oder auch erst Jahre danach, mitunter auch während einer Behandlung.
Möglich ist auch, dass die Depression chronisch wird. Je nach Schweregrad der Beschwerden unterscheidet man hierbei zwei Formen: Bei der chronischen Depression hält die depressive Episode länger als zwei Jahre ohne Besserung an. Bei der langanhaltenden depressiven Verstimmung, auch Dysthymie genannt, bestehen die Symptome ebenfalls über mehr als zwei Jahre. Sie sind aber weniger stark ausgeprägt als bei der klassischen Depression. Dennoch ist auch hier das Wohlbefinden einschränkt.
Diagnostik
Ob eine Depression vorliegt oder nicht, kann durch ein Gespräch mit einem Arzt oder Ärztin bzw. einem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin untersucht werden.
 Ähnlich wie bei körperlichen Erkrankungen gibt es auch für die Diagnose Depression feste vorgegebene Kriterien. Dabei gehen die Fachleute in zwei Schritten vor: Sie fragen zunächst anhand einer Liste ab, welche Depressions-Beschwerden in den letzten zwei Wochen aufgetreten sind. Dann müssen andere Erkrankungen, die ähnliche Symptome zeigen, ausgeschlossen werden.
Ähnlich wie bei körperlichen Erkrankungen gibt es auch für die Diagnose Depression feste vorgegebene Kriterien. Dabei gehen die Fachleute in zwei Schritten vor: Sie fragen zunächst anhand einer Liste ab, welche Depressions-Beschwerden in den letzten zwei Wochen aufgetreten sind. Dann müssen andere Erkrankungen, die ähnliche Symptome zeigen, ausgeschlossen werden.
Darüber hinaus werden Anzeichen zum Verlauf der Erkrankung erfasst, um zu unterscheiden, ob es sich um eine bisher einmalige oder eine wiederholte depressive Episode handelt.
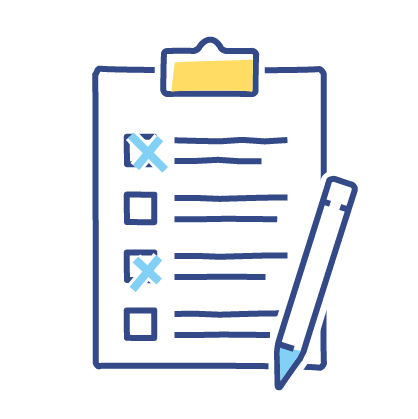 Ergänzend kommen manchmal spezielle Fragebögen zum Einsatz. Dort werden die Fragen nach Symptomen nicht nur mit Ja und Nein beantwortet. Die Fragebögen ermöglichen es, die Ausmaße der Beschwerden anhand einer Skala zu erfassen.
Ergänzend kommen manchmal spezielle Fragebögen zum Einsatz. Dort werden die Fragen nach Symptomen nicht nur mit Ja und Nein beantwortet. Die Fragebögen ermöglichen es, die Ausmaße der Beschwerden anhand einer Skala zu erfassen.
Anhand der Anzahl und der Stärke der Beschwerden lässt sich der Schweregrad der Depression beurteilen. Man unterscheidet:
- leichte Depressionen,
- mittelgradige Depressionen,
- schwere Depressionen.
Je nach Schweregrad der Depression kommen unterschiedliche Behandlungsansätze infrage.
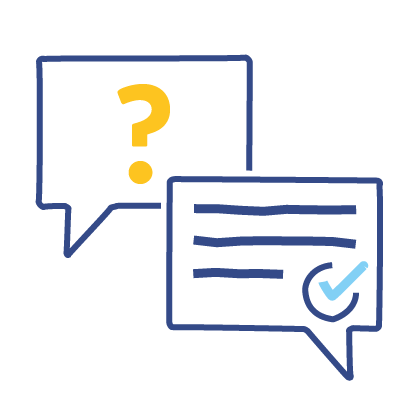 Depressions-Beschwerden können auch bei anderen psychischen oder körperlichen Erkrankungen auftreten. Für die Diagnose „Depression“ muss der Arzt oder die Ärztin deshalb prüfen, ob nicht möglicherweise andere Krankheiten vorliegen. Dies erfolgt im Rahmen eines ausführlichen Arzt-Patienten-Gesprächs und mithilfe einer körperlichen Untersuchung.
Depressions-Beschwerden können auch bei anderen psychischen oder körperlichen Erkrankungen auftreten. Für die Diagnose „Depression“ muss der Arzt oder die Ärztin deshalb prüfen, ob nicht möglicherweise andere Krankheiten vorliegen. Dies erfolgt im Rahmen eines ausführlichen Arzt-Patienten-Gesprächs und mithilfe einer körperlichen Untersuchung.
Die Depression muss von weiteren psychischen Erkrankungen abgegrenzt werden. Solche Erkrankungen sind zum Beispiel:
- Bipolare Störung
- Depressive Anpassungsstörungen bei Menschen, die belastende Erlebnisse hatten, z. B. den Verlust eines nahen Angehörigen
- Burnout-Syndrom
In bestimmten Situationen prüfen die Ärztinnen und Ärzte, ob eine körperliche Funktionsstörung im Gehirn depressive Symptome verursacht, z. B. bei Parkinson-Erkrankung oder Alzheimer-Demenz.
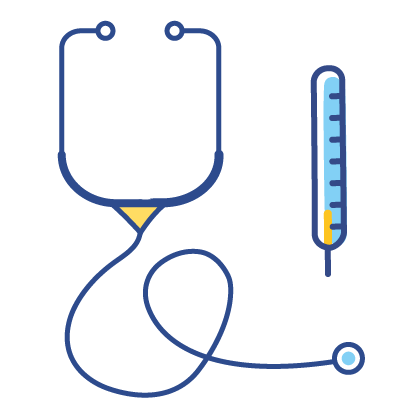 Depressions-Beschwerden können auch in Zusammenhang mit körperlichen Erkrankungen auftreten. Dazu zählen zum Beispiel Erkrankungen des Skelettsystems oder der Lungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hormonabhängige Erkrankungen, Allergien oder Infektionen. Zudem treten Depressionen auch zusammen mit anderen psychischen Erkrankungen wie Angst- oder Panikstörungen auf.
Depressions-Beschwerden können auch in Zusammenhang mit körperlichen Erkrankungen auftreten. Dazu zählen zum Beispiel Erkrankungen des Skelettsystems oder der Lungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hormonabhängige Erkrankungen, Allergien oder Infektionen. Zudem treten Depressionen auch zusammen mit anderen psychischen Erkrankungen wie Angst- oder Panikstörungen auf.
Um die Behandlung der Depression bestmöglich zu planen, kann der behandelnde Arzt, die Ärztin deshalb vorangegangene oder bestehende psychische und körperliche Erkrankungen erfragen. Zusätzlich ist es wichtig, die Medikamente oder Drogen, die eingenommen werden, zu dokumentieren.
Laut nationaler Versorgungsleitlinie sollen die behandelnden Ärztinnen und Ärzte darüber hinaus auch die persönliche Lebenssituation der Betroffenen erfassen. Wenn die Erkrankung den Alltag stark beeinträchtigt, können weiterführende Beratungsmöglichkeiten empfohlen werden.
Zusätzlich sollen Ärzte und Ärztinnen bei jedem Patientengespräch prüfen, ob die an Depression erkrankte Person auch Suizidgedanken hat. Bei akuter Suizidgefahr wird geprüft, ob eine Notfalleinweisung in eine Klinik nötig ist.
Verbreitung
Depressionen zählen zu den häufigsten psychischen Erkrankungen. Sie können in jedem Alter auftreten. In Deutschland ist bei etwa 16 von 100 Erwachsenen im Laufe Ihres Lebens irgendwann eine Depression festgestellt worden. Frauen sind dabei häufiger von der Erkrankung betroffen als Männer.
Ursachen und Entstehung
Wie genau eine Depression entsteht, ist bislang nicht eindeutig geklärt. Fachleute gehen davon aus, dass verschiedene Ursachen zusammenwirken und die Erkrankung auslösen. Dabei spielen sowohl Veranlagung und äußere Umstände als auch das eigene Umfeld eine Rolle.
Bestimmte körperliche und psychische Umstände sowie besondere Lebensereignisse erhöhen zudem das Risiko für eine Depression. Diese Umstände werden auch Risikofaktoren genannt.
Was kann das Auftreten einer Depression begünstigen?
- Wenn Familienmitglieder an Depression erkrankt sind oder waren
- körperliche Erkrankungen, wie Adipositas, Stoffwechselstörungen, Infektionen oder chronische Erkrankungen
- hormonelle Umstellungen, z. B. in der Pubertät, während der Schwangerschaft, im Wochenbett oder in den Wechseljahren
- psychische Störungen, wie z.B. Angststörungen
- Traumata, wie Missbrauch, Misshandlungen, Vernachlässigung, Krieg oder Verluste in der Kindheit
- Einsamkeit
- Belastende Lebensereignisse wie Trennungen, berufliche Enttäuschungen, schwerwiegende Diagnosen oder Todesfälle
- Lebensgewohnheiten wie Ernährung, Rauchen oder Bewegungsmangel
Ein hundertprozentiger Schutz vor Depression ist kaum möglich. Aber so wie es Risikofaktoren gibt, gibt es auch Schutzfaktoren. Darunter versteht man Eigenschaften oder Fähigkeiten, die dabei helfen, schwierige Lebenssituationen und Ereignisse besser zu bewältigen.
So können Persönlichkeitseigenschaften wie Zuversicht oder emotionale Ausgeglichenheit vor Depression schützen. Aber auch ein unterstützendes Umfeld mit Familie und Freunden sowie soziales Engagement, z. B. im Ehrenamt oder Verein, können eine Schutzwirkung ausüben.
Grundsätzlich helfen auch gesunde Lebensgewohnheiten, Depressionen vorzubeugen. Dazu zählt Folgendes:
- Stress abbauen
- Entspannung fördern
- Regelmäßig Sport und Bewegung in den Alltag einbauen
Es ist möglich, solche Schutzfaktoren gezielt aufzubauen und zu stärken. So lassen sich beispielsweise soziale Fähigkeiten, Problemlösetechniken und Stressbewältigungsstrategien erlernen. Dazu bieten unter anderem die Krankenkassen, aber auch andere Träger wie Volkshochschulen oder kirchliche Organisationen Kurse an. Diese können Themen wie Stressabbau, Entspannung oder Achtsamkeit im Alltag umfassen.




